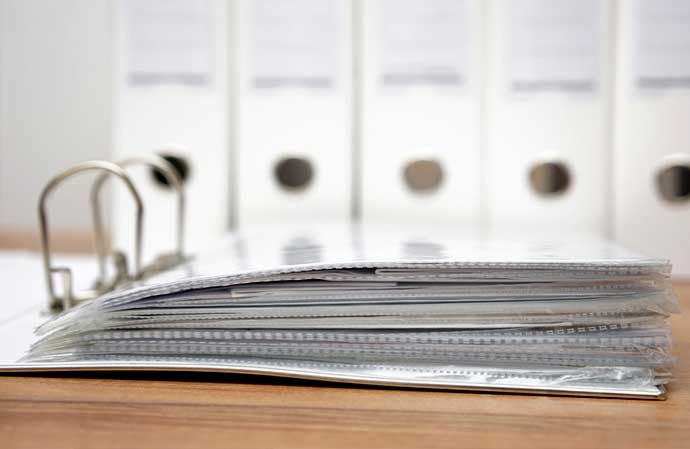Neuerungen durch das MoPeG: Muss die GbR jetzt im Gesellschaftsregister eingetragen werden?
Einleitung
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) am 1. Januar 2024 hat sich das Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) grundlegend geändert. Erstmals gibt es ein öffentliches Gesellschaftsregister für GbRs, das dem Handelsregister nachgebildet ist. Bislang existierte ein solches Register nicht. Die Existenz und Zusammensetzung einer GbR ließen sich im Rechtsverkehr – anders als bei der OHG, KG oder GmbH – nicht zuverlässig ermitteln und nachvollziehen. Durch das MoPeG wurde diese Publizitätslücke geschlossen. Die §§ 707 ff. BGB n.F. sehen nunmehr die Möglichkeit vor, eine GbR beim zuständigen Amtsgericht im Gesellschaftsregister registrieren zu lassen.
Die Eintragung ist allerdings kein Selbstzweck: Bestimmte wichtige Rechtsgeschäfte setzen seit 2024 eine vorherige Eintragung der GbR voraus. Im Folgenden erläutern wir, was sich geändert hat und worauf GbR-Gesellschafter achten sollten.
Keine Eintragungspflicht, aber oft faktischer Zwang
Grundsätzlich muss eine GbR auch nach neuem Recht nicht ins Gesellschaftsregister eingetragen werden. Das Gesetz spricht von einer bloßen Eintragungsoption (vgl. § 707 Abs. 1 BGB n.F.). GbR-Gesellschafter können ihre Gesellschaft also nach wie vor ohne Registereintrag gründen und führen. Auch reine Innengesellschaften bleiben unverändert möglich.
Obwohl das Gesetz keine generelle Registerpflicht normiert, setzt es für bestimmte Transaktionen, die ihrerseits eine Eintragung in ein anderes Register erfordern, eine vorherige Eintragung der GbR im Gesellschaftsregister zwingend voraus:
Grundstücksgeschäfte
Eine GbR kann seit dem 01.01.2024 Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte (z. B. Erbbaurechte) nur erwerben oder veräußern, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen ist. Nach § 47 Abs. 2 GBO n.F. darf das Grundbuchamt Rechte für eine GbR nur noch eintragen, wenn diese zuvor als „eingetragene GbR“ (eGbR) im Gesellschaftsregister registriert wurde. Beim Immobilienkauf oder -verkauf durch eine GbR ist die Registereintragung jetzt also faktisch zwingende Voraussetzung. Für bereits im Grundbuch eingetragene Alt-GbRs gilt zwar Bestandsschutz, doch auch sie müssen vor einer künftigen Verfügung zunächst eingetragen werden!
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
Ähnliches gilt, wenn eine GbR Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften erwerben möchte. Zwar ist die Eintragung einer GbR in das Gesellschaftsregister keine zwingende Voraussetzung für den Erwerb eines Geschäftsanteils – gleichgültig ob es sich um eine Personen- oder Kapitalgesellschaft handelt.
Allerdings wird die neuen GbR-Gesellschafterin nur dann in das Handelsregister (und etwaige Gesellschafterlisten) eingetragen, wenn diese ihrerseits als eGbR im Gesellschaftsregister registriert ist. Damit ergibt sich auch in diesem Fall ein faktischer Eintragungszwang.
Die Eintragung der GbR (bzw. eGbR) als Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft im Handelsregister ist von essenzieller Bedeutung.
Bei einer GmbH gelten die Gesellschafter gegenüber der GmbH nur dann als Gesellschafter, sofern diese in die beim Handelsregister geführte Gesellschafterliste aufgenommen sind. So ordnet § 40 Abs. 1 S. 3 GmbHG n.F. an, dass eine GbR erst in die Gesellschafterliste einer GmbH eingetragen werden kann, nachdem sie als eGbR registriert wurde. Für das Aktienregister bei Namensaktien und für die Eintragung als OHG-/KG-Gesellschafter gilt Entsprechendes.
Auch bei einer KG hat die Eintragung – vor allem des Kommanditisten – im Zweifel weitreichende Haftungsfolgen. Denn von der Haftung werden nur solche Kommanditisten befreit, die mit ihrer Haftsumme im Handelsregister als Kommanditist eingetragen sind. Die Eintragung ist aber davon abhängig, dass die GbR im Gesellschaftsregister eingetragen ist.
Eine Eintragung der GbR ist also in den meisten Fällen unumgänglich.
Für bestehende Gesellschaften gilt ein Bestandsschutz. Eine Eintragung der GbR wird erst im Rahmen der Vornahme neuer Rechtsgeschäfte erforderlich oder wenn sich im Gesellschafterbestand etwas ändert.
IP-Rechte und Umwandlungen
Auch bei anderen registerpflichtigen Rechtspositionen ist die Eintragung einer GbR nun vorausgesetzt. So verlangt das neue Recht die Registereintragung der GbR etwa vor der Eintragung von IP-Rechten (Marken, Patente) auf den Namen der GbR. Schließlich kann eine GbR nur dann an einer Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz (Formwechsel, Verschmelzung, Spaltung) teilnehmen, wenn sie zuvor als eGbR im Gesellschaftsregister eingetragen geworden ist. Mit anderen Worten: Nur die eGbR ist nach der Reform ein umwandlungsfähiger Rechtsträger!
Die vorstehenden Beispiele verdeutlichen, dass die Eintragung einer GbR in das Gesellschaftsregister für eine aktive Teilnahme am Rechtsverkehr in einigen Fällen zwingend notwendig ist.
Wann kann die Eintragung noch sinnvoll sein? Und wann ist sie es nicht?
Neben den vorstehend beschriebenen Fällen, in denen eine Eintragung im Gesellschaftsregister faktisch notwendig ist, kann in einigen Fällen aber auch von einer Eintragung abgesehen werden. Dies gilt zum Beispiel für reine Innengesellschaften. Eine BGB-Innengesellschaft (auch Innen-GbR genannt) ist eine Personengesellschaft, die nicht nach außen in Erscheinung tritt, sondern lediglich zur Regelung des Verhältnisses der Gesellschafter untereinander besteht. Eine solche kann beispielsweise in Form einer Bürogemeinschaft, einer stillen Beteiligung an einem Unternehmen oder auch in einer Stimmbindungs- bzw. Poolvereinbarung liegen. Eine reine Innengesellschaft ohne Außenwirkung braucht nicht eintragen zu werden.
Auch eine kleine projektbezogene GbR, etwa als ARGE (Arbeitsgemeinschaft) für ein bestimmtes Bauprojekt oder ein Gründerteam in der Frühphase kann zunächst ohne Registereintrag bestehen.
Bei der freiwilligen Eintragung einer Außen-GbR sollte jedoch bedacht werden, dass die Eintragung selbst, aber auch jede spätere Änderung, etwa bei einem Gesellschafterwechsel der notariellen Beglaubigung bedarf. Zum anderen ist eine Eintragung als eGbR unumkehrbar. Zur Beendigung einer eGbR muss diese liquidiert werden, um eine Löschung aus dem Gesellschaftsregister zu ermöglichen.
Im Übrigen unterliegt die eGbR weiteren Publizitätspflichten. Sie muss z.B. ihre wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister melden und Gesellschafterwechsel sowie Änderungen des Gesellschaftszwecks oder der Vertretungsbefugnis unverzüglich nachmelden.
Die neue Rechtslage bietet jedoch auch Anreize, die freiwillige Eintragung in Erwägung zu ziehen. Denn die Eintragung kann rechtlich vorteilhaft oder ratsam sein, selbst wenn kein faktischer Zwang besteht:
Antizipation künftiger Geschäfte
Wenn absehbar ist, dass die GbR in Zukunft Grundstücke erwerben, Investorengelder gegen Gesellschaftsanteile erhalten oder in andere Unternehmen einsteigen möchte, ist eine freiwillige frühzeitige Registeranmeldung empfehlenswert. So lässt sich vermeiden, dass sich ein geplanter Immobilienkauf oder eine Beteiligung verzögern, da man auf die Eintragung der GbR warten muss. Da die Eintragung (mit notarieller Anmeldung) einige Wochen dauern kann, sollte man rechtzeitig vorsorgen.
Klare Rechtsverhältnisse
Eine Eintragung schafft Transparenz hinsichtlich des Bestandes, der Zusammensetzung und den Geschäftsführern der Gesellschaft. Dritte, etwa Geschäftspartner, Banken oder Behörden, können im öffentlichen Register einfach und kostenlos prüfen, wer Gesellschafter ist und wer die eGbR vertreten darf. Das stärkt das Vertrauen und die Rechtssicherheit im Geschäftsverkehr. Für eine aktive GbR kann es daher schon aus Präventionsgründen sinnvoll sein, als eGbR aufzutreten, auch wenn aktuell kein Zwang vorliegt.
Weitsicht
Die eGbR bietet mehr Gestaltungsoptionen. Soll die GbR später in eine haftungsbeschränkte Gesellschaft (z. B. GmbH) umgewandelt werden, kann dies als eingetragener Rechtsträger im Wege des Formwechsels nach dem UmwG erfolgen. Ohne Registereintrag wäre ein solcher Formwechsel nicht sofort möglich und Verzögerungen infolge des Wartens auf die Eintragung müssten eingeplant werden. Für wachsende Unternehmen (Start-ups) kann die eGbR daher ein Sprungbrett sein, um nahtlos in eine passendere Rechtsform zu wechseln, wenn die Geschäftsentwicklung es erfordert.
Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer Eintragung. Gesellschafter einer GbR sollten sich darüber bewusst sein, welche Art der Teilnahme am Rechtsverkehr gelebt wird und werden soll, um prüfen zu können, ob die Eintragung faktisch zwingend oder zumindest sinnvoll ist.
Gern unterstützen wir Sie in diesem Prozess.